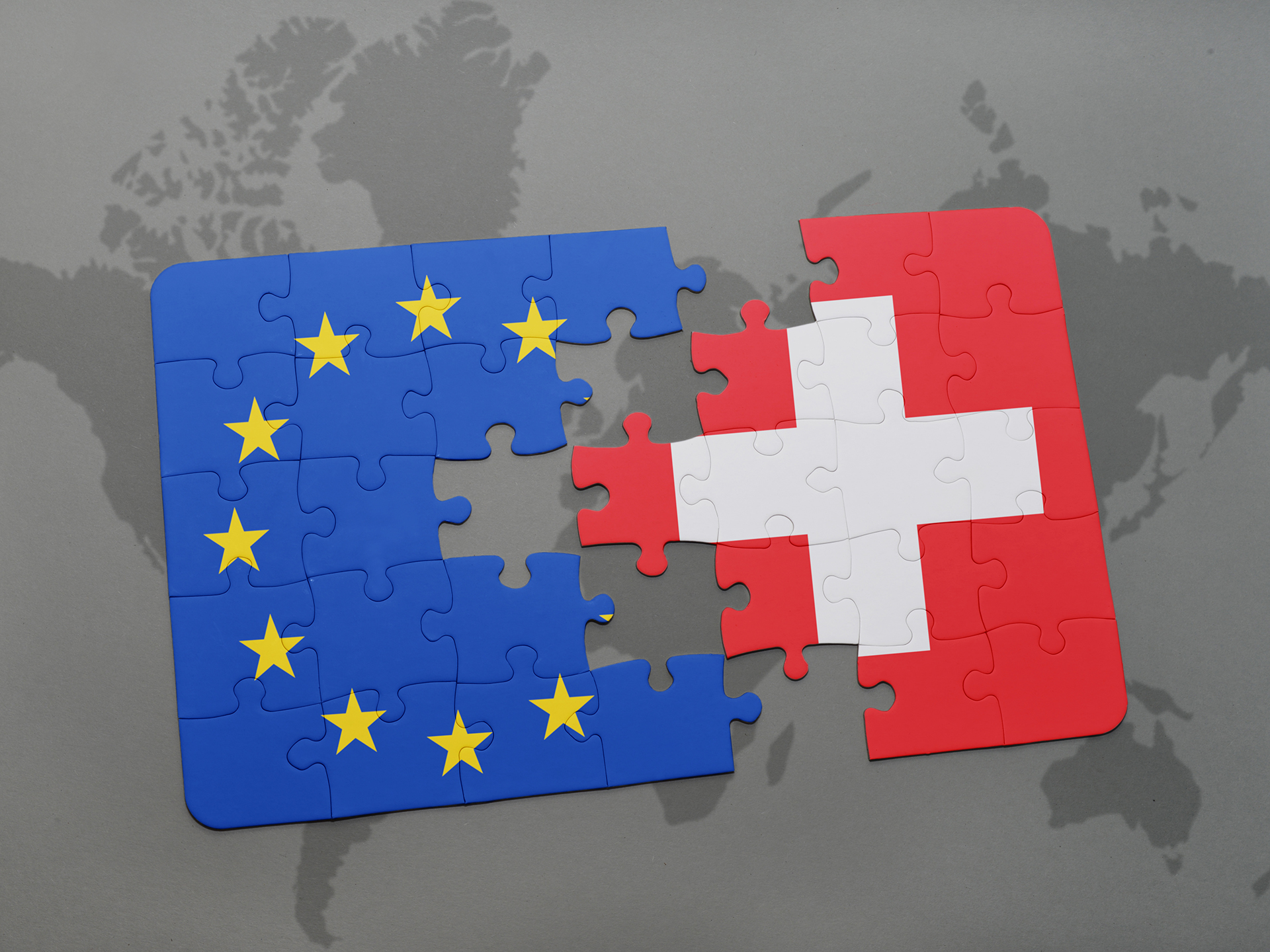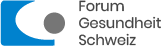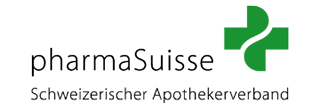Forum Gesundheit Schweiz
Für eine liberale Gesundheitspolitik, die auf Qualität und Innovationen setzt

Digitalisierung: Das Schweizer Gesundheitswesen ist bereit
Die Schweiz bringt alle Voraussetzungen für die digitale Transformation des Schweizer Gesundheitswesens mit. Dennoch rangiert unser Land bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen auf den hinteren Rängen. Mit dem Programm DigiSanté soll das Schweizer Gesundheitswesen fit für die Zukunft werden.
News
Der konkrete Nutzen von Digital-Health-Lösungen in der Schweiz
Am Sessionsanlass des Forum Gesundheit Schweiz wurden die Ergebnisse einer exklusiven Studie präsentiert, welche die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in unserem Auftrag durchgeführt hat.
Schweiz – EU: Wichtiges Kooperationsabkommen im Bereich Gesundheit
Der bilaterale Weg soll fortgesetzt werden: Nach dem Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen plant der Bundesrat ein Paket, das die Weiterentwicklung bestehender und den Abschluss neuer Abkommen ermöglicht – auch im Bereich Gesundheit. Warum das für unser Land wichtig ist.
Newsletter

Nr. 51 – Dezember 2023
Qualität statt Menge vergüten – Digitalisierung beschleunigen, Nutzen betonen – EFAS: Die Vorlage schlank ins Ziel bringen
Das Schweizer Gesundheitssystem
Präsidium

Damian Müller
- Ständerat Luzern
- Präsident Forum Gesundheit Schweiz
Für eine liberale Gesundheitspolitik
Unser Gesundheitssystem gehört glücklicherweise zu den besten der Welt. Davon profitieren wir alle – auch, aber nicht nur während einer Pandemie.
Doch die Qualität unseres Gesundheitssystems hat einen sehr hohen Preis. Deshalb lautet die entscheidende Frage: Wie können wir Patientinnen und Patienten sowie Versicherten die bestmögliche medizinische Qualität bieten, gleichzeitig aber die Bezahlbarkeit des Systems gewährleisten?
Exakt mit solchen Themen beschäftigt sich das Forum Gesundheit Schweiz (FGS). Wir engagieren uns für eine freiheitliche Ausrichtung des Schweizer Gesundheitssystems. Wir stehen für eine liberale Gesundheitspolitik ein, die auf Qualität und Innovationen setzt. Zudem sollen die Vorteile der Digitalisierung genutzt werden – zum Wohl der Patientinnen und Patienten.
Forum Gesundheit Schweiz
Im Forum Gesundheit Schweiz sind Persönlichkeiten und Organisationen vertreten, die sich für ein qualitativ hoch stehendes und kosteneffizientes Gesundheitswesen mit wettbewerblichen Elementen einsetzen. Das Forum wurde im Frühjahr 2006 gegründet.
Unsere Ziele
Dem Forum liegt ein qualitativ hoch stehendes, aber finanzierbares Gesundheitswesen am Herzen. Es will zu einem breit abgestützten Konsens über eine wirkungsvolle Eindämmung der Kostenzunahme im Gesundheitswesen beitragen, indem es marktwirtschaftliche Lösungen in die Diskussion einbringt.
Das Forum und seine Mitglieder wollen
- darlegen, dass es für ein qualitativ hoch stehendes und kosteneffizientes Gesundheitswesen wettbewerblich organisierte Elemente braucht,
- alles tun, um die Qualität des Gesundheitswesens zu steigern und einer weiteren Verstaatlichung des Gesundheitswesens entgegen zu wirken,
- Kostentransparenz und Eigenverantwortung bei allen Akteuren erreichen,
- die Chancen der Digitalisierung zum Wohle der Patientinnen und Patienten nutzen,
- aufzeigen, dass neue Lösungen zu einer Eindämmung der Kostenzunahme im Gesundheitswesen beitragen können.